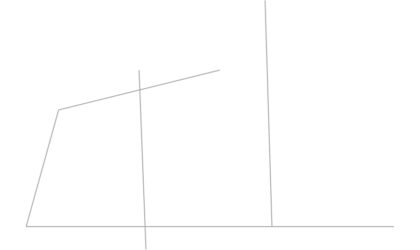Derzeit läuft am Volkstheater mit »Feuerherz« eine Mischung aus Goethe, Plenzdorf, Eick und Punk à la »Feine Sahne Fischfilet«. Die Idee ist spannend und das zweistündige Stück ein unterhaltsames Erlebnis. Dennoch zeigt sich: Zwar geht es viel ums Herz, aber das lodernde Feuer fehlt. Oder um es mit Shakespeare zu sagen: Viel Lärm um (fast) nichts.
Goethe war der Urheber. Plenzdorf hat in seinen Fassungen aus den 1970ern die damals gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR diskutiert. Eick wollte in der 2007 uraufgeführten nächsten Fassung das Leben der ersten volljährig werdenden Post-DDR-Generation und deren von zunehmenden gesellschaftlichen Freiheiten und Ansprüchen geprägten Leiden unter die Lupe nehmen. Nun, beinahe zehn Jahre danach, kommt das Stück auf die Bühne des Rostocker Volkstheaters. Die musikalische Ausgestaltung ist nicht mehr von »Black Tequila«, sondern stammt nun aus der Feder der Punk-Band »Feine Sahne Fischfilet«. Die Vorzeichen deuten auf ein kontrastreiches Ereignis hin. Spiegelt sich das am Ende aber auch inhaltlich wider?
W.‘s Leiden hat mit seinem Tod ein Ende genommen. Freunde, Bekannte, Vater und Mutter erinnern sich an W. – und hinterfragen, was geschehen ist und ob sie für W. da waren, oder doch zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen sind. Das Stück wird in Rückblenden erzählt und zeigt dabei, wie W.‘s Leiden durch das kontinuierliche Scheitern an den Erwartungen der Welt und des sozialen Umfelds an sein Leben steigt. Der gewählte Weg erscheint jedoch zu plump und oberflächlich in der Darstellung. W. scheitert an der musikalischen Aufnahmeprüfung. W. steht vor dem Jugendstrafgericht wegen unerlaubter Nutzung fremden Eigentums. W. wird von seinen Lehrern nicht ernst genommen und unter Druck gesetzt. Die üblichen Verdächtigen werden ins Spiel gebracht. Bildungs- und Ordnungsinstanzen werden als Problemverursacher benannt, die durch feststehende Wege und Bahnen die freie Entfaltung des Individuums einschränken. Sie zerren W. in ein Korsett, das die Luft abschnürt. W. scheitert am (Non)Konformismus. Und zuletzt ist es auch die verwirrende und teilweise unerwiderte Liebe zu Lotte, die den jungen W. zerbrechen lässt. W., zehn Jahre jünger als Lotte, zieht sie mit seinem jugendlichen Charme, freien Denken und der Unbedarftheit, die damit einhergehen, an. Dennoch lässt sie sich nicht auf W. ein, genießt nur sein Werben, die Aufmerksamkeit, die sie erhält, und auch den Hauch von Freiheit, den er für sie verkörpert. Die Verlobung und auch die bereits eingeschlagenen starren Wege in die Zukunft riskiert sie nicht. Der Seitensprung mit W. soll einmalig bleiben.
Lotte ist für W. die erste große Liebe – und dementsprechend blauäugig denkt er, dass es nur noch sie und niemand anderes mehr geben kann. In der Verwirrung und aus dem Leiden heraus äußert er Monchi, seinem besten Freund, gegenüber, wie es wohl wäre, wenn er mit allem Schluss macht, sich das Leben nimmt und nicht mehr da wäre. Und so wechseln sich im Stück plötzlich eine Minute lang die mit dem Zeigefinger aufgesetzten Kopfschüsse von W. und die lautstarke Aufforderung von Monchi ab, endlich mit dem »Scheiss« aufzuhören, denn sowas ist nicht komisch. Allerdings war es das aber auch – und darunter leidet die Aufführung. Die Problematisierung und Diskussion gesellschaftlicher und individueller Zustände erfolgen nur auf einer oberflächlichen und auch recht stereotypen Ebene. Das Stück spielt lediglich mit der verbalen Behauptung des Vorhandenseins von Problemen und Leiden, macht diese aber nicht wirklich erfahrbar. Stattdessen wird immer wieder weitläufig mit der Moralkeule ausgeholt, wenn auf die Bedeutung sozialer Beziehungen, insbesondere von Freundschaft, hingewiesen wird. Unerträglich wird es im Schluss-Monolog von Monchi, der das Publikum auffordert, am besten gleich nach Ende des Stücks sich mal wieder Zeit für die besten Freunde zu nehmen. Recht hat er – aber bitte nicht so plakativ.
Ein Freund fasste es nach der Vorführung prägnant zusammen: »Da war mal wieder der Erklär-Bär unterwegs.« Das Stück macht zu viele Worte – um (fast) nichts. Es ist mehr Schein als Sein. Das Gefühl, als Jugendlicher verloren zu sein, nicht zu wissen, wo man steht, was man will, wer man ist und sich die ganze Zeit auf der Suche nach der eigenen Identität zu befinden, wird zum zentralen Thema – und dennoch nur oberflächlich und sich darin wiederholend angesprochen. Die Gesellschaft, in die man hineingeboren wurde, ist am Ende ein unpräziser Rahmen, der zu wenig Beachtung findet. Die Leiden des jungen W. schildern nur implizit das in allen Generationen stets wiederkehrende Problem, nicht zu wissen und zu verstehen, wer man ist, wer man sein kann und wer man sein will. Die Fragen, die man sich stellt, bleiben gleich, nur der (gesellschaftliche) Hintergrund, vor dem sie auftreten, ist immer wieder anders.
Am Ende verlässt man das Theater mit dem Gefühl, ein spannendes Stück erlebt zu haben, dass die Zuschauer auch auf eine selbstbezogene, aber nicht zu intensive reflexive Reise mitgenommen hat. Die Musik von »Feine Sahne Fischfilet« ist eine wunderbare Ergänzung des Stücks, aber gerade die neu komponierten Songs haben sich, genau wie das Stück selbst, zu sehr im Kreis gedreht. Das eigentliche Drama wird zu sehr aus der sicheren Distanz einer stabilen Umlaufbahn beobachtet. Ein involvierendes Drama entsteht allerdings erst dann, wenn sich die Stabilität auflöst, die Gravitationskräfte zuschlagen und alles in sich zusammenstürzt. Das hat »Feuerherz« nicht geschafft. Ein äußerst gelungenes und beeindruckendes Bühnenbild, hervorragende Schauspieler sowie spannende und auch erheiternde Einfälle in der Inszenierung machen jedoch nicht den inhaltlichen Kern des Stücks aus. Dieser ist leider noch meilenweit von dem inhaltlichen Potential, das entfaltet und diskutiert werden könnte, entfernt.
Die Theater-Aufführung hinterlässt daher denselben bitteren Beigeschmack, der sich auch bei Filmen immer wieder einstellt, etwa bei Luc Besson’s »Lucy« (USA 2014): Die interessanten Fragen und Themen werden nur angedeutet. Eine gelungene Inszenierung und die Einbringung einzelner neuer Ideen – weder in Film noch in Theater – täuschen am Ende nicht über die mangelhafte Diskussion individueller und gesellschaftlicher Aspekte und die eigentliche Banalität des Inhaltes hinweg. Allein die Handlung macht noch keine gute Geschichte aus. Dennoch ist es schön zu wissen, dass beinahe alle angesetzten Aufführungen ausverkauft sind. Letztendlich ist es sowieso jeder Zuschauer für sich, der zeigt, was über das Gesagte hinaus aus dem Stück herausgeholt werden kann. Wer sich darüber hinaus mit der intensiven und reflexiven filmischen Auseinandersetzung mit dem Leiden der Jugend beschäftigen will, der sollte sich »Wir Sind Jung. Wir Sind Stark.« (D 2015) von Burhan Qurbani und den bald volljährig werdenden »The Faculty« (USA 1998) von Robert Rodriguez ansehen. Der »Erklär-Bär« spielt dort zumindest keine Rollen.