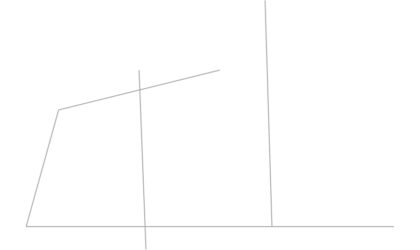In leistungs- und erfolgsorientierten Gesellschaften ist das Scheitern ein regelmäßiger, aber äußerst unliebsamer Begleiter. Der Rostocker Soziologe Matthias Junge rückt das Phänomen derzeit wieder in den Mittelpunkt seiner Forschung – und erläutert dessen Bewältigung.
In der massenmedialen Öffentlichkeit ist vor allem das Scheitern von Prominenten präsent und bietet immer wieder neuen Diskussionsstoff. Bundespräsidenten, Minister, Manager und viele andere werden hautnah beim Scheitern beobachtet. Auch das Interesse der Wissenschaft konzentriert sich derzeit darauf – und zeigt, dass gerade die soziologische Forschung stagniert. Prof. Dr. Matthias Junge beschäftigt sich nach zehn Jahren erneut mit dem Scheitern. Ein zugehöriger Band wird Ende 2015 erscheinen. Erste Einblicke und Perspektiven liefert Prof. Junge im heuler.
Laut Matthias Junge hat die Soziologie zum Thema Scheitern nichts Ernsthaftes beizutragen. Bisherige soziologische Auseinandersetzungen beginnen und enden an einem bestimmten Punkt: Fehler werden gemacht, um daraus zu lernen – Fehler werden gemacht, um es danach besser zu machen. „Die Soziologie ist eine handlungstheoretische Wissenschaft – und Scheitern ist ein Widerfahren, da handelt man nicht“, erklärt Prof. Junge. „Interessant für die Soziologie wird es erst, wenn die Scheiternsbewältigung betrachtet wird. Dann muss man nämlich handeln.“
In modernen Gesellschaften hängen Scheitern und Erfolg eng miteinander zusammen. „Wir leben jetzt in einer Phase, wo der gesellschaftliche Erfolg fast alles dominiert. Gerade dann ist besonders das Scheitern ärgerlich.“ Matthias Junge sieht hier einen wichtigen Eckpfeiler der soziologischen Betrachtung. Zwar sind es vor allem Individuen, die scheitern, aber sie scheitern innerhalb der sie umgebenden gesellschaftlichen Strukturen. Aus soziologischer Sicht sieht er daher ein grundlegendes Problem in der fehlerhaften Ursachenzuschreibung: „Man schreibt sich das Scheitern selbst zu, indem man es als Misslingen fehlinterpretiert. Die richtige Strategie wäre aber, nach den strukturellen Ursachen zu suchen. Die Gründe des Scheiterns sind sofort zu externalisieren. Wenn man sie internalisiert, wenn man also sagt, dass man selbst den Fehler gemacht hat, dann läuft es von vornherein schief. Man wird nicht einfach arbeitslos, sondern man muss sofort fragen, warum man vom Arbeitsmarkt aus dessen Strukturen entlassen wurde.“ Eine Fehlqualifikation kann die Ursache auf der individuellen Seite sein, aber der Grund liegt auf der strukturellen Ebene, nämlich in den Ansprüchen und Regeln des Arbeitsmarkts.
Eine Soziologie des Scheiterns muss daher das Individuum in gesellschaftliche Strukturen eingebettet sehen, statt sich nur auf das individuelle Scheitern zu konzentrieren. „Normalerweise erfolgt unsere Handlungsplanung auf der Grundlage, dass wir kalkulieren, was alles schiefgehen kann. Unsere Handlung besteht darin, diese Fallstricke zu vermeiden. Gerade dabei treten aber im Regelfall neue Fallstricke auf, die wir vorher nicht bedacht haben, die sogenannten ungesehenen Nebenfolgen des Handelns.“ Lässt sich das Scheitern also nicht vermeiden, liegt die anschließende Aufgabe in der Scheiternsbewältigung. Die Comicfigur Donald Duck aus Entenhausen bewältigt ihr permanentes Scheitern, indem sie immer wieder weitermacht und nicht aufgibt. Trotz aller Misserfolge überwindet Donald Duck diese, weil er überzeugt ist, dass er beim nächsten Versuch erfolgreich sein wird. Dadurch befindet er sich im ständigen Kreislauf von Scheiternsbewältigung und dem Scheitern an der Scheiternsbewältigung. „Donald Duck würde scheitern, wenn er Erfolg hat. Dann wäre die Figur gescheitert und der Mythos zerstört. Er hätte einen Identitätsschaden, denn er weiß, dass er eigentlich scheitern muss.“
Die Scheiternsbewältigung, die im Film oder in der Literatur ein gängiges Mittel zur Figuren- und Handlungsentwicklung ist, wird in der sozialen Realität nicht immer so explizit beleuchtet. „Der Moment des Scheiterns, insbesondere von Prominenten, ist für die Gesellschaft unheimlich wichtig.“ Matthias Junge denkt dabei insbesondere an die Argumentation eines Klassikers der Soziologie, die des Franzosen Émile Durkheim, und meint: „Wir brauchen abweichendes Verhalten, damit wir wissen, wie wir uns ohne Abweichung zu verhalten haben. Das heißt: Scheiternde sind als Symbol für eine Gesellschaft unverzichtbar. Es muss einige Scheiternde geben, damit man weiß, dass dieser Weg nicht zum Erfolg führt. Wir brauchen Scheiternde, damit die Erfolgskultur der Gesellschaft aufrechterhalten werden kann. Sie haben also eine unverzichtbare gesellschaftliche Funktion. Das ist allerdings den Scheiternden schlecht zu vermitteln. Vor allem dann, wenn nur der Moment des Scheiterns für die Gesellschaft wichtig ist, die individuelle Bewältigung aber irrelevant wird.“ Dementsprechend bleibt nur zu fragen: Wer spricht derzeit noch von den gescheiterten Ex-Bundespräsidenten und Ministern sowie deren Bewältigungsstrategien? Das öffentliche Interesse hat nach dem Scheitern und dessen Konsequenzen schlagartig nachgelassen.
Matthias Junge zufolge ist aus soziologischer, aber auch individueller Perspektive das Entscheidende, dass man sofort wieder anfängt zu handeln, um aus der Situation herauszukommen. „Solange man in der Situation verharrt, macht man sich selbst zum Opfer der Verhältnisse und man kann gut sehen, wie drastisch die Konsequenzen sein können. Wenn man zwischen sich und der Situation nicht mehr unterscheiden kann, dann verschmelzen beide miteinander und man wird von den Ereignissen getrieben, statt sie selbst zu steuern. Dann verliert man die Handlungsfähigkeit und im letzten Schritt sogar die Autonomie. Das sind die katastrophalen Folgen, die mit dem Scheitern verbunden sein können, wenn man nicht handelt. Das Handeln suggeriert aber, dass die Handlungsfähigkeit wieder zurückkommt. Dann ist man auf einer guten Spur.“ Deshalb ist Donald Duck – bei allem Pech – auf gewisse Art und Weise dennoch erfolgreich.
Das Scheitern ist eine normale Erfahrung und kann auch positiv wirken. Man muss dem Scheitern einen Sinn abgewinnen und wieder handlungsfähig werden, sodass man lernen kann, mit dem Scheitern umzugehen. Dass das leichter gesagt als getan ist, vor allem im Studium, weiß auch Matthias Junge. „Das Scheitern bei einer Prüfung – das sage ich als Professor ganz entspannt – ist das Beste, was einem passieren kann, weil man als Konsequenz weiß, dass es so nicht geht und man dann zum Beispiel den Lernstil ändert. Schlechte Noten sind also nicht wirklich schlecht, sondern sie sind gut, weil man daraus lernen kann, es anders zu machen.“ Das eigentliche Ziel bleibt aber dennoch, die Prüfung zu bestehen. Scheitern ist also hochgradig subjektiv und normativ, es orientiert sich immer an idealtypischen Vorstellungen. Wer scheitert, der muss sich auf einen Plan B einigen. In der Regel ist der anvisierte Plan B ein angepasster Plan A. Zur leichteren Bewältigung des Scheiterns sieht Matthias Junge vor allem eine große Bedeutung im sozialen Netzwerk eines Individuums. „In einer neuen Stadt muss man erst einmal Fuß fassen und Leute kennenlernen – denn mit einem großen Netzwerk im Hintergrund kommt man mit dem Scheitern besser klar, indem man dessen unterschiedliche Ressourcen zur Bewältigung nutzt.“
Vom Scheitern spricht man häufig geradezu selbstverständlich, aber gibt es eine passende Definition für das Phänomen? Soziologisch abstrakt lässt es sich für Matthias Junge nur so ausdrücken: „Scheitern ist strukturell verursachte Unmöglichkeit.“ Wie das wiederum zu verstehen ist, lässt sich Ende 2015 in „Plan B – Scheitern und Erfolg“ nachlesen.
Autor: Clemens Langer sieht die positiven Seiten des Scheiterns – und freut sich, dass der Artikel dennoch fertig geworden ist.