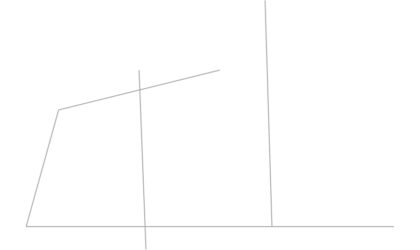David Fincher, Regisseur von modernen Thrillern wie »Sieben«, »Alien3«, »The Game«, »Verblendung« und »Fight Club«, widmet sich erneut einer literarischen Vorlage. Scheinbar muss an dieser etwas dran sein, wenn er sich damit beschäftigt. Das war der Irrtum, als ich mit der Lektüre von »Gone Girl« begann. Erleichterung brachte erst die Bullshit-Theorie.
Die Lektüre von »Gone Girl« ist ein Erlebnis der Widersprüche. Die Prämisse ist spannend: Ein Vorzeige-Paar steht im Mittelpunkt des Interesses. Allerdings verbirgt sich hinter der Fassade nur die gute Miene zum bösen Spiel. Als Amy Dunne auf einmal verschwindet, wird Nick Dunne zusehends zum Verdächtigen, der mit dem Verschwinden etwas zu tun haben könnte. Welche Motive könnte er haben, um Amy loszuwerden? Wer kommt sonst noch in Frage? Langsam zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu und auch der Leser gewinnt kein hundertprozentiges Vertrauen – zu zwielichtig zeichnet Gillian Flynn den Mann in der Mitte des Medien- und Untersuchungsrummels.
Zu zwielichtig? Nicht wirklich. Eine Zwielichtigkeit des Charakters würde es erst interessant machen. Die Autorin ist aber in einer ausdauernden Sprunghaftigkeit zwischen Spannung, Verwirrspiel, Banalität und Langeweile gefangen, als hätte sie die Herausforderung angenommen, den Leser um jeden Preis zum unvollendeten Abschluss der Lektüre zu bringen. Jede weitere Seite wird zu einer neuen Art der Qual für den Leser. Vom Page-Turner à la Stieg Larsson ist der Roman von Gillian Flynn bei weitem entfernt. Eine fesselnde Lektüre ist anders gestrickt. Das Problem lässt sich häufig nur überbrücken, indem man auf den Bullshit-Lesemodus wechselt. Die Methode lautet: Keine Zeit mit dem Nachdenken über den gelesenen Nonsens verbringen, sondern die Dinge, die die Welt nicht interessiert, hinnehmen und weiterlesen.
Nick Dunne und seine Amazing Amy werden in Tagebucheinträgen und Erinnerungen lebendig. Als dreidimensionale Wesen intendiert, bleiben sie jedoch über weite Teile nur zweidimensional. Der Leser fragt sich vielleicht sogar, weshalb man sich auf das Geschehen einlassen sollte. Was soll an beiden so interessant sein, um mit den Figuren Zeit zu verbringen? Der Aufhänger, der Knall-Effekt, der einen erst ins Geschehen hineinzieht, lässt bis weit über die Hälfte des Buches auf sich warten. Tatsächlich beginnt dann ein anderes Buch – das eigentliche Buch. Alles, was zuvor war, ist nur der Prolog. Wer bis hierher durchgehalten hat, wird mit einer spannenden Wendung belohnt. Der Schreibstil wird aber wenig besser. Unzählige und langatmige Klammerbemerkungen säumen die Seiten und stören den Lesefluss – bei einem Thriller nicht gerade ein probates Stilmittel. Gillian Flynn versucht die Protagonistin lebendig werden zu lassen, indem Amy über das Tagebuch zum Leser spricht, um diesen zum Zeugen einer Entwicklung und Kompagnon werden zu lassen. Allerdings: Im Sprachgebrauch setzt man keine Klammern. Während der großartige Stieg Larsson jeden Satz zielgerichtet zu Papier gebracht hat und man beim Lesen trotz aller Spannung keine Zeit verliert, fühlt sich bei »Gone Girl« der Weg bis zum Ende einer Seite endlos an. Jedes geschaffte Kapitel gleicht einem Erfolg.
Dennoch: Das Buch ist nicht schlecht oder zu verdammen. Zu viele interessante Ideen stecken drin. Die Spannungskurve und Involvierung bauen sich nur zu langsam auf und werden von einem verkomplizierenden und langweiligen Schreibstil begleitet. Das Potential wird verschenkt. Der Pluspunkt liegt aber in der Beschreibung von Nick Dunne, denn man hat den Eindruck, die Autorin hatte von Anfang an eine Verfilmung mit Ben Affleck in der Titelrolle im Blick. In jeder Bubi-Beschreibung von Nick Dunne sieht man sein Gesicht. Immerhin: Das Ziel wurde erreicht. Vielleicht schafft es David Fincher die Spannung zu steigern und den Stoff über die Durchschnittlichkeit zu heben. Einziger Nachteil: Gillian Flynn hat auch das Drehbuch geschrieben. Eventuell ist sie aber eine bessere Drehbuch-Autorin als Schriftstellerin.