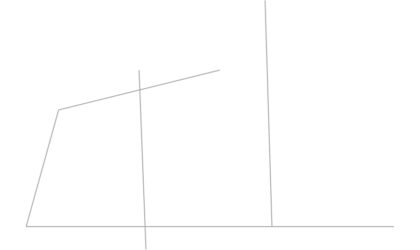Zwei Welten prallen aufeinander. In der einen ist es stets Nacht und wenn die Menschen wieder aus dem Schlaf erwachen, sind sie nicht mehr, wer sie vorher waren. In der anderen erscheint alles normal, aber die Lebenswege sind vorherbestimmt. Der Zusammenprall zeigt die Schnittmenge: Der kleine Makel der Unberechenbarkeit lässt die Menschen nicht ruhen.
»Dark City« (USA 1998) ist nicht so bekannt wie der damalige Blockbuster »The Matrix« (USA 1999), spielt aber durchaus mit denselben Themen wie dieser – und ist vielleicht auch einer der besten Science Fiction-Filme überhaupt. Die Atmosphäre erinnert an den Film Noir. Während alle anderen Menschen in der Stadt noch schlafen, erwacht ein Mann mit Gedächtnisverlust. Alles, was er über sich weiß, ist, dass er J. Murdoch heißen muss. Aber wer ist J. Murdoch und hat er wirklich den Mord an einer Prostituierten begangen? Langsam versucht er die fehlenden Teile zu finden, das Puzzle zusammenzusetzen und das Mysterium um sich, die Stadt, die ewig anhaltende Dunkelheit, die bleichgesichtigen Fremden und die Frage, warum keiner weiß, wie man nach Shell Beach kommt, an das sich doch alle so deutlich erinnern, zu lösen. Bei allen Anleihen an Film Noir und Science Fiction, die »Dark City« aufbietet, liegt dem Werk eine zutiefst anthropologische Fragestellung zugrunde: Was treibt den Menschen in seinem tiefsten Inneren eigentlich an? In »The Matrix Revolutions« (USA 2003) fragt Agent Smith am Ende Neo, warum er einfach nicht aufgeben will. Die Antwort ist schlicht, aber nicht wirklich hilfreich: »Weil ich mich so entschieden habe.« Regisseur Alex Proyas sowie die Autoren Lem Dobbs und David S. Goyer vermeiden in »Dark City« dieses banale Schlupfloch jedoch gekonnt. Der Schlüssel dazu lautet, ein Bewusstsein für das Unbewusste zu haben. Dies ist es auch, woran die Fremden im Film scheitern. Die Prägungen und Veränderungen in Charakteren, Architektur, Struktur, Vergangenheit und Gegenwart, die sie wiederholt während der Schlafenszeit vornehmen, helfen nicht dabei, das Wesen des Menschen tiefgreifend durchdringen zu können. Das Bewusste ist am Ende auch nur ein unscheinbares Phänomen der Komplexität menschlichen Seins. Das Unbewusste ist hingegen geradezu un(er)fassbar.
In die Kerbe der thematisierten Willensfreiheit schlägt auch »Der Plan« (USA 2011). Die Prämisse der Story ist, dass hinter dem offensichtlich grenzenlosen Spielraum menschlicher Entscheidungen ein Planungsbüro steckt, das alle Wege eines Individuums vorab plant. Bei Abweichungen von der Vorherbestimmung greift es immer wieder korrigierend ein. Bisher ist das Büro am langfristig verfolgten Ziel, die Menschheit zu entkoppeln und dem wirklich freien Willen zu überlassen, stets gescheitert. Jeder Versuch führte in dunkle Zeitalter. Nach Rom und dem Einsetzen der Industrialisierung mussten die Herren des Planungsbüros im Auftrag des Vorsitzenden wieder eingreifen, um zu verhindern, dass die Menschheit gänzlich aus der Bahn gerät. David Norris, ein aufstrebender Kongressabgeordneter, und Elise Sellas, eine erfolgreiche Tänzerin, waren in einem ursprünglichen Plan einmal füreinander bestimmt gewesen, aber es hat sich nichts entwickelt. Der Plan wurde daher angepasst und in eine neue Richtung gelenkt. Die menschliche Unberechenbarkeit führt aber dazu, dass sie später und entgegen aller Vorstellungen, Planungen und Gegenmaßnahmen umso bewusster und energischer zueinander finden wollen. Dürfen sie zusammenkommen – oder nicht? Werden sie zueinanderfinden – oder nicht? Oder steckt hinter allem ein viel größerer Plan, der sie dazu bringen soll, endlich vom freien Willen Gebrauch zu machen?
Zwar steht bei beiden Filmen Science Fiction drauf, aber es steckt sehr viel mehr drin. In beiden liegt ein außergewöhnliches Erlebnis verborgen, das einen zu einem einjährigen Kind werden lässt, dem man einen Punkt auf die Stirn gemalt hat. Das erste Mal erkennt es nun bewusst, dass der Punkt auf der eigenen Stirn ist – und das große Abenteuer Leben beginnt.