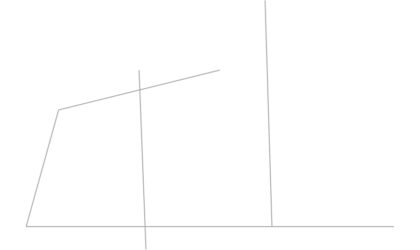Man kann Film als ein Unterhaltungsmedium ansehen, aber auch als ein Sprachrohr, um gesellschaftliche Zu- und Missstände aufzuzeigen. Ein genaues Maß, wann was zutrifft, gibt es nicht – es bleibt dem Auge des Betrachters überlassen. Unterscheiden sich aber Kritik in Film und Fernsehen?
Regisseur David Fincher hat mit der Verfilmung von Chuck Palahniuks Roman »Fight Club« (USA 1999) eine für Hollywood untypische und provokante Interpretation individualisierter, postmoderner Gesellschaften geschaffen. Der namenlose Protagonist ist gefangen in einer reizüberladenen, anonymisierten, katalogisierten und portionierten Welt, in der die individuelle Bestimmung und Erfüllung auf einen konsumorientierten Lebensstil reduziert ist. Er hatte alles – und: »Ich war so kurz davor mich vollständig zu fühlen.« Nachdem seine IKEA-Wohnung explodiert ist und er über den Verlust und die Zukunft nachdenkt, findet er in Tyler Durden einen Freund, der unkonventionell agiert und das Gegenteil eines folgsamen und unkritischen modernen Individuums ist. Tyler Durdens Blick auf die Gesellschaft dekonstruiert sie und zeigt dem Protagonisten, wie sehr er als freies Individuum doch nur an Strippen hängt und eine Marionette ist. Alles andere ist nur eine Illusion, denn: »Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsessionen. […] Ich sage: Fühl dich nie vollständig. Ich sage: Schluss mit der Perfektion. Ich sage: Entwickeln wir uns, lass die Dinge einfach laufen.« Sonst heißt es am Ende: »Alles, was du hast, hat irgendwann dich.« Die materielle Befriedigung eines künstlich geförderten Bedürfnisses wird zum Fass ohne Boden – und man fühlt sich weiterhin verloren und isoliert. Die individuellen sozialen Bedürfnisse, die einen lebendig fühlen lassen, bleiben auf der Strecke. Wer ist man, was macht einen aus, wo gehört man hin und wie stehen die Anderen zu einem? Was ist die Gesellschaft für mich – und was bin ich für die Gesellschaft? Die Inhaltsleere der Antwort führt bei den Männern des Fight Club zu dem simplen Bedürfnis, sich physisch zu erleben, aus der körperlichen Gewohnheit auszubrechen, sich durch Gewalt zu zerstören und dabei wieder lebendig zu werden. Der Rausch, die Schmerzen, die Gewalt und die Macht in der Prügelei lassen sie eine vermisste Erfahrung machen. In diesem Augenblick macht die sonst anhaltende Bedeutungslosigkeit eine Pause. Der Fight Club als kontrastierender Gegenpol gesellschaftlicher Normalität wird so zur brachialen, aber befreienden Kritik an einer zunehmend ignorierenden und isolierenden Gesellschaft.
Wer äußert im Film aber eine Kritik – und wie? Sie erscheint lediglich verschlüsselt, äußerst abstrakt und für den Zuschauer nicht mehr unmittelbar zugänglich. In TV-Sendungen können hingegen individuelle Meinungen geäußert und zugeordnet werden. Der Unterschied ist, dass im Film Gesellschaft nicht vollständig rekonstruiert werden kann, sondern eine komplexitätsreduzierte Variante innerhalb einer Story konstruiert wird. Im TV-Gespräch kann man jedoch in wenigen Sätzen reale Phänomene aufgreifen und an dieses adäquatere Abbild die Kritik adressieren. Gesellschaftliche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können dabei miteinander verknüpft werden. Helmut Schmidt und Joachim Gauck haben diese Kunst in der Diskussion um die Gemeinschaft Europas deutlich unter Beweis gestellt. Derzeitige Entwicklungen wurden mit den Perspektiven, Standpunkten und Optionen von Jugendlichen und anderen Generationen verknüpft. Das Individuum wurde also nicht nur auf sich selbst zurückgeworfen betrachtet, wie es die legitime Prämisse von »Fight Club« ist, sondern als Bestandteil gesellschaftlicher und transnationaler Kontexte.
Tyler Durden spricht von einer fehlenden Depression, die für neue Bewegung sorgt. Helmut Schmidt und Joachim Gauck sprechen auch von prägender Vergangenheit – und neuen Herausforderungen. Der gemeinsame Nenner ist der Blick auf die Bewältigung von beidem, also von individueller und gesellschaftlicher Gegenwart.