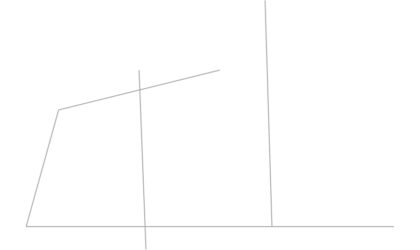Viele Filme schicken die Zuschauer auf erlebnisreiche, abenteuerliche, schockierende, spannende oder dramatische Reisen und bieten Unterhaltung pur. Nur die wenigsten Filme schaffen es aber auch ergreifend zu sein. Zwei solche Sternstunden sind in »Ziemlich Beste Freunde« (F 2011) und »The Straight Story« (USA 1999) zu finden.
Man kann von ganz unterschiedlichen Dingen ergriffen sein, ein filmisches Patentrezept gibt es nicht. Vielleicht ist aber allem gemein, dass sich dieses Gefühl erst zum Ende eines Filmes mit der letzten Sequenz einstellt, wenn die Reise, auf die man mit den Protagonisten gemeinsam gegangen ist, endet. Wer ist zum Beispiel nicht den Tränen nahe, wenn am Ende von »Die Monster AG« (USA 2001) der pelzige Riese James P. »Sulley« Sullivan von seinem Freund Mike Glotzkowski die Möglichkeit bekommt, seine schmerzlich vermisste Boo wiederzusehen? Die Tür wird geöffnet, er schaut vorsichtig in das dunkle Zimmer, vernimmt ein zartes, kindliches »Katze« und seine Augen werden groß und strahlend vor Freude.
Einer der wohl schönsten Filme mit solch einem Ende stammt von einem der skurrilsten Regisseure. David Lynch, dessen Filme häufig non-linear sind, absurde Charaktere aufweisen und gerne die Grenzen von Zeit, Raum und Rationalität aufbrechen, hat hier ein Werk der Geradlinigkeit, Einfachheit und Ruhe geschaffen, das den Zuschauer auf die Reise eines Lebens mitnimmt. Der 73-Jährige Alvin Straight erhält eines Tages den Anruf, dass sein Bruder, mit dem er sich zehn Jahre zuvor zerstritten hat, einen Schlaganfall hatte. Obwohl er aufgrund nachlassender Sehkraft das Auto nicht mehr nutzen darf, steht fest, dass er die 500 Meilen lange Strecke zu Lyle allein auf sich nehmen muss. Ein Rasenmäher von John Deere muss her und die Tour geht los, auf der er vielen unterschiedlichen Leuten begegnet und dabei auch sein Leben Revue passieren lässt. Als Alvin Straight gefragt wird, ob er nachts denn so mutterseelenallein keine Angst hätte, fällt die Antwort kurz, aber enorm vielschichtig aus: »Wissen Sie, Ma’am, ich war im zweiten Weltkrieg Soldat. Wovor soll ich mich da nachts in einem Kornfeld fürchten?« Unbeschreiblich intensiv. Die abenteuerliche Reise bringt zudem ganz andere, schlichtere Gefahren mit sich, als man es sonst in Filmen gewohnt ist. Aber sie sind umso realer. In der wohl actionreichsten Szene des Films steigt daher die Sorge um diesen Kauz unerwartet an, als auf einer leicht abschüssigen Straße die Bremsen am Rasenmäher versagen. Unwiderstehlich spannend. Zwischendrin wird ein Ausblick auf das mögliche Ende gegeben. Das erschließt sich einem in dem Augenblick zwar nicht, aber am Ende weiß man, dass es genau so richtig ist.
Ebenso verhält es sich bei dem modernen französischen Klassiker über den Tetraplegiker Philippe und seinen ungehobelten Pfleger Driss, der es durch seine Art – und nicht durch geheucheltes Interesse oder Mitleid – schafft, für Freude im Leben von Philippe zu sorgen, der sich dadurch als Mensch und nicht als Last wahrgenommen fühlt. Die unterschiedlichen Milieus und kulturellen Stile dieses ungleichen Paares sorgen immer wieder dafür, dass sie aus dem jeweiligen Einerlei herausbrechen und aneinander wachsen. Während der Titel im französischen Original »Die Unberührbaren« oder »Die Unantastbaren« bedeutet und damit auch auf Nebencharaktere und deren Beziehungsgeflechte untereinander verweist, die sich im Laufe des Films herausbilden, erscheint der deutsche Titel einfach passender. Der Spaß und die Bedeutung einer innigen Freundschaft kommen wunderbar zum Tragen. Wie schon bei David Lynch ist es auch hier der Schluss, der den Zuschauer mit einem Gefühl von Harmonie in Kopf und Herz entlässt – denn ziemlich beste Freunde verstehen sich gerade ohne Worte.
Was verbindet nun diese beiden Filme miteinander? Die Enden zehren schlichtweg von dem Sprichwort: »Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.« In diesem Augenblick erscheinen sie dann auch wie die Erfüllung eines Herzenswunsches – und man ist ergriffen.