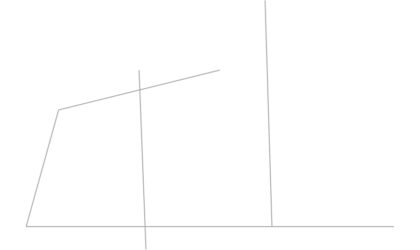Box-Filme üben einen besonderen Reiz auf das Publikum aus. Im Gegensatz zu anderen Dramen bieten diese einen großen und abstrakten Spielraum zur Identifikation des Zuschauers mit der Filmfigur. Die Identifikation ist unmittelbarer und intensiver, denn der Boxer ist, wie man selbst auch, ein »Joe Somebody«, der sich durch alle Widrigkeiten boxt. Andere Dramen rekurrieren hingegen auf Besonderheiten. Die Metapher des Box-Kampfes als Befreiungsschlag ist jedoch weitläufiger und spricht auf breiter Ebene an – eben Jedermann. Und dennoch können die Filme manchmal unterschiedlicher nicht sein.
»Rocky« (USA 1976) ist das global wohl populärste Beispiel. Nicht zuletzt dürfte die Fanfare aus den Trainingssequenzen ein prägnantes und bekanntes Merkmal sein. Einerseits schreitet sie energisch voran, andererseits schwingt eine Leichtfüßigkeit mit, die einen trotz aller Niederschläge nicht nachgeben lassen will. Über die Filmreihe hinweg hat sich das Thema des boxenden Underdogs fest in die Filmgeschichte eingeschrieben und fast jeder Teil ist auch ein Neustart für die Karriere von Sylvester Stallone gewesen. Gegen alle Widrigkeiten und Chancenlosigkeiten haben sich Figur und Schauspieler immer wieder aufgerappelt. Das Drama von Rocky hatte den Ausgangspunkt fast immer in dessen sozialer Position und Prägung. Das Ziel war nicht der soziale Aufstieg oder nur die äußere Anerkennung, sondern die innere Standfestigkeit, die sich nach außen und ins Soziale überträgt. Rocky zeichnet sich durch Disziplin, harten Einsatz und Durchhaltevermögen aus – eben jene klassischen (körperlichen) Elemente, die den »American Dream« kennzeichnen. Die Figur will sich dadurch selbst definieren und zeigen, dass sie mehr Wert ist: »’Cause all I wanna do is go the distance. Nobody’s ever gone the distance with Creed, and if I can go that distance, you see, and that bell rings and I’m still standin’, I’m gonna know for the first time in my life, see, that I weren’t just another bum from the neighborhood.«
Im metaphorischen Gehalt des Trainings und des Box-Kampfes findet Rocky eine Aussage für sich selbst. Gleichzeitig liegt darin auch der größte Identifikationsspielraum für den Zuschauer. Nicht umsonst sind die sogenannten »Rocky Steps« in Philadelphia zu einem Phänomen der aus Jedermann bestehenden Real-Life-Rocky‘s geworden. Ständig rennen Leute unterschiedlichster sozialer Zugehörigkeiten in Rocky-Manier die Stufen hinauf und lassen der Assoziation freien Lauf – egal, ob es um den individuellen Abstiegskampf geht oder erfreuliche Ereignisse wie Hochzeit oder Nachwuchs bevorstehen. Die Metapher von Rocky wird individuell.
Demgegenüber steht das Box-Drama »The Fighter« (USA 2010), das jedoch an den Stellen lediglich Punkte sammelt, an denen Rocky zum »Knock-Out« ansetzt. Micky Ward ist keine sozial entkoppelte Figur wie Rocky. Auch wenn beide einer Unterschicht entstammen, sind vielmehr die Bindungen relevant. Rocky weist diese nur zu Adrian und Paulie, dem Trainer Mickey und den beiden Schildkröten Klay und Frazier auf. Micky Ward hingegen ist an enge Blutsbande geknüpft, was dem Drama eine andere Richtung verleiht. Nicht die Gesellschaft, sondern die Gemeinschaft wird dort problematisiert. Der Konflikt ergibt sich aus den Charakteren, die innerlich wie äußerlich an Micky Ward zerren. Das dramatische Element liegt also nicht mehr im Protagonisten selbst. Während bei Rocky die Box-Kämpfe als vielschichtige Höhepunkte des »social struggle« eines Einzelnen angesehen werden müssen, wird der Titelkampf in »The Fighter« zu einer Randerscheinung. Einerseits ist es intensiv inszeniert, andererseits aber abgekürzt und oberflächlich. Der selbstreferentielle Boxer ist hier nicht mehr vorhanden. Zwar müssen beide viel einstecken, aber die Disziplin, der Wille und die innere Lösung des Konflikts – und somit das Essential der Figur und der Identifikation mit dieser – kommen nur bei Rocky zum Tragen. Insofern ist es für Micky Ward lediglich ein »fight«, aber kein »struggle«.